Česká Kamenice
(Böhmisch Kamnitz)

Blick auf die Stadt vom Zámecký vrch (Schlossberg).
Foto: Jiří Kühn.
Česká Kamenice (Böhmisch Kamnitz) ist eine alte Stadt mit einer reichen Geschichte, die im Tal des Flusses Kamenice (Kamnitz) etwa 15 km östlich von Děčín (Tetschen) und 11 km westlich von Nový Bor (Haida) liegt. Ihre Umgebung ist von malerischen bewaldeten Hügeln des Lausitzer Gebirges, der Böhmischen Schweiz und des Böhmischen Mittelgebirges umgeben. Zur Stadt gehören auch die Ortschaften Dolní Kamenice (Nieder Kamnitz), Filipov (Philippsdorf), Horní Kamenice (Ober Kamnitz), Huníkov (Henne), Kamenická Nová Víska (Kamnitzer Neudörfel), Kerhartice (Gersdorf), Líska (Hasel) und Pekelský Důl (Höllegrund) mit insgesamt 5196 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021).
Geschichte

Blick auf das Stadtzentrum vom Turme der St. Jakobskirche.
Foto: Jiří Kühn.
Česká Kamenice entstand in einer waldreichen Gegend, die bereits im 11. Jahrhundert von den Lausitzer Sorben spärlich besiedelt wurde. Irgendwann in den 1360er und 70er Jahren wurde es von den Marquartingern kolonisiert. An der Kreuzung der alten Handelsstraße von Litoměřice (Leitmeritz) nach Bautzen mit der von Děčín nach Zittau führenden Straße am Fluss Kamenice wurde ein langgestrecktes Waldhufendorf gleichen Namens gegründet. Neben Kamenice wurden in diesem Gebiet wahrscheinlich auch Kunratice (Kunersdorf), Líska, Kerhartice, Veselé (Freudenberg) und Janská (Johnsbach) gegründet. Der zentrale Teil von Kamenice wurde später zur Stadt erhoben. Aus den Randgebieten entstanden die Ansiedlungen Horní und Dolní Kamenice (Ober- und Nieder-Kamnitz. Die Erhebung zur Stadt kann bereits vor 1283 erfolgt sein, als König Wenzel II. die Herrschaft Šarfenštejn (Scharfenstein) an Jan von Michalovice (Johann von Michelsberg) verschenkte, oder aber erst Ende des 13. Jahrhunderts. Kamenice wird zum ersten Mal schriftlich als „Kempnicz“ im Register des päpstlichen Zehnten aus dem Jahr 1352 erwähnt, als es bereits seit einiger Zeit den Rang einer Stadt hatte.
Im Jahr 1378 übernahm Johann III. von Michelsberg die Verwaltung der Herrschaft Scharfenstein und verlieh der Stadt eine Reihe von Privilegien. 1380 erhielt die Stadt das Recht, ein Stadtbuch zu führen, das zu den ältesten in Böhmen gehört und bis heute erhalten geblieben ist. Kamenice unterlag dem Stadtrecht von Litoměřice und wurde anfangs von einem Erbvogt, dem so genannten „fojt“, geleitet, dessen Stellung jedoch allmählich abnahm, so dass der Stadtrat um 1490 das Amt des Erbvogtes kaufte und das Amt des Vogtes in das eines dem Stadtrat unterstellten Landvogtes umwandelte. Im Jahr 1493 wurde ein neues Rathaus gebaut, das an die Stelle der alten Vogtei trat. Offenbar gab es hier 1380 auch eine Schule, die aber erst 1416 erwähnt wird. Die ersten urkundlich erwähnten Stadtprivilegien gehen auf Januar 1383 zurück, als Johann III. den Bürgern von Česká Kamenice, Chřibská (Kreibitz) und den umliegenden Dörfern das Heimfallrecht bestätigte, das Vermögen der Verstorbenen im weiten Verwandtenkreis zu erben. Eine Urkunde aus dem Jahr 1394 verlieh den Bewohnern von 67 Stadthäusern das Recht, Bier zu brauen und zu verkaufen, ein städtisches Badehaus zu betreiben und Zölle auf eingeführte Waren zu erheben. Im selben Jahr wurde die örtliche Schützenbruderschaft privilegiert. Im 15. Jahrhundert verlieh die Obrigkeit der Stadt auch das Halsrecht, das auf dem Šibeniční-Berg (Galgenberg) nördlich der Stadt bis ins 17. Jahrhundert nördlich der Stadt ausgeübt wurde.
Jan III. von Michelsberg verschuldete sich jedoch und musste 1406 den größten Teil der Herrschaft Šarfenštejn an Hynek Berka von Dubá verkaufen, der seinen Sitz in Hohnstein hatte. Dessen Söhne teilten die Herrschaft nach 1419 auf und der jüngste, Jan Berka von Dubá, erhielt Česká Kamenice und Chřibská. Er stellte sich während der Hussitenkriege auf die Seite von Kaiser Sigismund, weshalb die Stadt zwischen 1423 und 1426 mehrmals von den Hussiten besetzt und wahrscheinlich auch geplündert wurde. Nach dem Tod von Jan Berka von Dubá im Jahre 1428 wurde die Herrschaft Kamenice von Sigismund von Wartenberg gekauft, der sie an Děčín angliederte. Zu dieser Zeit war Sigismund jedoch bereits auf der Seite der Hussiten und unternahm Raubzüge in die Lausitz. Bald wurde er gefangen genommen und in Jindřichův Hradec (Neuhaus) eingekerkert, wo er 1438 starb. Während seine Söhne Jan und Jindřich ihre Raubzüge fortsetzten, marschierten die Görlitzer Truppen 1440 gegen die Wartenberger, brannten Anfang Mai Česká Kamenice nieder und zerstörte die Burg Fredevald. Vier Jahre später griffen die Truppen der Lausitzer Sechsstädte die Wartenberger Burgen erneut an und im Mai 1444 wurde sogar Česká Kamenice erobert und niedergebrannt. Schließlich zwangen die hohen Kriegskosten Johannes von Wartenberg 1450 dazu, mit den Sechsstädtern Frieden zu schließen.
Der folgende wirtschaftliche Aufschwung der Stadt war mit der Gründung von Handwerkszünften verbunden. Die erste Zunft wurde 1457 von den Schneidern gegründet, 1480 eine Metzgerzunft, drei Jahre später eine Bäckerzunft. Im Jahre 1496 gab es ein Zunftprivileg der Schmiede. Auch die Mälzer bildeten um 1500 eine eigene Gemeinschaft, die jedoch erst 1516 schriftlich erwähnt wurde. 1492 erhielten die Bürger das Recht, Bier ausschließlich in den umliegenden Dörfern zu verkaufen.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts schwand die Macht der Wartenberger. 1511 kaufte Nikolaus Trčka von Lípa die gesamte Herrschaft Děčín. Im Jahre 1515 wurde sie von der Familie Salhausen von Meißen erworben, unter deren Herrschaft sich hier die protestantische Religion ausbreitete. Im Jahr 1522 teilten die Salhausener die Herrschaft Děčín und Šarfenštejn mit Benešov (Bensen), Kamenice und Žandov (Sandau) wurde Friedrich von Salhausen übergeben. Wahrscheinlich im Jahre 1529 wurde der Kamnitzer Teil der Herrschaft als Mitgift an seine Tochter Anna von Salhausen gegeben, die ein Jahr zuvor Prokop Wartenberg heiratete, wodurch die Herrschaft Kamenice endgültig von Šarfenštejn getrennt wurde. Die Wartenberger bauten sich daraufhin ein neues Schloss in der Stadt, von dem aus sie die Herrschaft Kamenice bis 1614 verwalteten.

Blick auf das Stadtzentrum von der Jehla (Nolde) aus.
Foto: Jiří Kühn.
Da die Landwirtschaft in der Vorgebirgsregion nicht sehr ertragreich war, verdingten sich viele Einwohner als Waldarbeiter, verarbeiteten Holz und bauten allmählich den selbstgesponnenen Flachs, die Strickerei, die Weberei und in geringerem Maße die Glasherstellung aus. 1536 erhielt die Stadt von König Ferdinand I. das Recht, zwei alljährliche Märkte abzuhalten. 1616 wurde der Stadt von Kaiser Matthias ein drittes Marktrecht verliehen. 1568 gewährten die Wartenberger Česká Kamenice das Recht, in der Stadt und den umliegenden Dörfern Salz zu verkaufen. Im Jahr 1562 wurde in der Nähe der Kirche eine neue Schule gebaut. Ab 1576 gab es dort eine Mädchenschule. Eine wichtige soziale Rolle spielte die Schützenbruderschaft, die einen Schießstand mit einer Wiese besaß, auf der Schützenfeste abgehalten wurden.
Während des Hochwassers vom 16. Juli 1577 zerstörte der Fluss vier Häuser in der Stadt vollständig, riss das Kunratická-Tor ein und beschädigte acht weitere Gebäude schwer. Im Oktober 1584 wurde die Stadt auch von der Pest heimgesucht. Dennoch wuchs die Stadt weiter, und zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges zählte sie bereits 207 Häuser mit 1250 Einwohnern.
Im Jahre 1614 kaufte Radslav Vchynský von Vchynice (Wchinitz) und Tetov (Tettau) das Gut des verschuldeten Jan von Wartenberg. Nach dessen Tod im Jahre 1619 übernahm Wilhelm Kinský das Gut. Dieser wurde jedoch 1634 zusammen mit Albrecht von Wallenstein in Eger ermordet, und ein Jahr später wurde Kamenice von Jan Oktavián aus dem Chlumecer Zweig der Familie Kinský übernommen, in dessen Besitz die Herrschaft bis zur Verwaltungsreform 1850 blieb.
Während des Dreißigjährigen Krieges zogen zahlreiche Heere durch die Stadt, die Unterkunft, Verpflegung und Futter für ihre Pferde benötigten. Plünderungen und Brandschatzungen waren keine Seltenheit, unabhängig davon, ob es sich um eigene oder feindliche Truppen handelte. Zwischen 1631 und 1635 plünderten die Sachsen die Gegend. Später kamen die Schweden und zerstörten der örtlichen Überlieferung zufolge im April 1639 die Reste der Kamenický hrad (Burg Kampnitz).
Nach der Schlacht am Weißen Berg begann die Rekatholisierung Böhmens, die in Kamenice zunächst nicht sehr erfolgreich war. Noch 1650 waren von den 2500 Gläubigen vor Ort nur etwa 60 katholisch, ein Jahr später waren es bereits 1321. Im Jahr 1672 wurde die Stadt rein katholisch. Die Anhänger von Luthers Lehren mussten Böhmen verlassen, meist nach Sachsen oder in die Lausitz. Trotz des Leids der Einwohner überstand die Stadt den Dreißigjährigen Krieg ohne größere Schäden. Von den ursprünglich 207 Häusern wurden 1654 nur 7 aufgegeben. Mehr als hundert Handwerker und Kaufleute waren zu dieser Zeit in der Stadt tätig.

Gebäude der ehemaligen Bürgerbrauerei im nördlichen Teil der Stadt.
Foto: Jiří Kühn.
Jan Oktavián Kinský begann bereits 1639 mit dem Brauen des städtischen Biers. Spätestens 1652-1653 verbot er den Verkauf des städtischen Biers in den umliegenden Dörfern, was zu lang anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Bürgern und der Obrigkeit führte. Im März 1680 brach mit der Anhebung der Frondienste ein Aufstand auf dem Gut aus. Im Gebiet des späteren Střelnice (Schießplatz) versammelten sich innerhalb von drei Wochen 1700 bewaffnete Leibeigene, die sich erst nach einem Zusammenstoß zwischen Bauern und Soldaten bei Dolní Libchava (Nieder Liebich) auflösten. Im Jahr 1713 breitete sich in der Stadt die Pest aus, die 68 Todesopfer forderte.
Ende des 17. Jahrhunderts begannen die Kinskys, die unrentable landwirtschaftliche Produktion einzuschränken, und konzentrierten sich auf die Entwicklung von Textilien und Glasherstellung. Die Textilproduktion wurde von Faktoren organisiert, die das Garn von den Spinnern kauften, es an die Weber verteilten und die fertigen Produkte weiterverkauften. Im Jahr 1724 gab es in Česká Kamenice 275 Handwerker und Kaufleute, und Leinen wurde damals praktisch in jedem Haus gesponnen.
Im Jahr 1733 wurde die Siedlung Filipov auf dem frei gewordenen Land der Herrschaft errichtet. Auch am Stadtrand wurden neue Häuser gebaut. Auf dem Gelände des ehemaligen Oberen Hofs wurde eine neue herrschaftliche Brauerei errichtet, die 1758 oder 1759 abbrannte. Deren Wiederaufbau dauerte bis 1761. In den Jahren 1780-1783 ließ die Familie Kinský eine neue Brauerei errichten. Nach 1752 wurde der Stadt von der Obrigkeit das Recht zum Bierbrauen entzogen. Die Streitigkeiten zwischen der Obrigkeit und der Stadt wurden erst 1795 beendet, als den Bürgern der Bau einer neuen Bürgerbrauerei hinter der Marienkapelle aufgetragen wurde.

Das Eingangstor des Schlosses.
Foto: Jiří Kühn.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde das Leben der Einwohner durch die preußisch-österreichischen Kriege belastet. Während des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1756 wurde die Stadt von preußischen Soldaten besetzt, die Lebensmittel requirierten und mehrere Häuser plünderten. Nach der verlorenen Schlacht von Kolín zogen sie sich hierher zurück und wurden vom 18. bis 20. Juli 1757 von der österreichischen Armee in der Nähe von Líska und dem Wowczakův vrch (Himmertschberg) unterhalb des Studenec (Kaltenberg) angegriffen. An die blutigen Schlachten erinnern noch heute Denkmäler in Studený (Kaltenbach), Líska und am Sattel bei der Křížový buk (Kreuzbuche). Auch 1778 kam ein preußisches Korps in die Stadt, forderte große Mengen an Vorräten und erpresste ein hohes Lösegeld. Die Österreicher schleppten eine Pockenepidemie ein, der etwa 600 Menschen, zumeist Soldaten, zum Opfer fielen. Nach den kargen Jahren von 1770-1772 plagten auch Hungersnöte und steigende Preise die Bevölkerung. Am 29. Juli 1775 versammelten sich die verärgerten Untertanen vor dem Schloss, doch nach Verhandlungen mit der Obrigkeit gelobten sie Treue.
Im Jahr 1749 erbte František Oldřich Kinský die Herrschaft Kamenice, die 1764 um Mistrovice (Meistersdorf) mit einem Meierhof erweitert wurde, auf dessen Parzelle 1764-1767 das neue Dorf Oldřichov (Neu Ullrichstal) gegründet wurde. Im Jahre 1796 wurde auch der Meierhof in Kamenická Nová Víska parzelliert. In der Stadt und ihrer Umgebung entwickelte sich die Garn- und Fadenbleiche, die Leinen- und Strumpfproduktion, die allmählich dominierte und sich im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts in Manufakturwerkstätten zu konzentrieren begann.
Ein Großbrand am 14. Juni 1787 zerstörte 38 Häuser im unteren Teil der Stadt. Am 2. Mai 1804 überschwemmte das Hochwasser der Kamenice den Platz und die angrenzenden Straßen im westlichen Teil der Stadt. Während der napoleonischen Kriege kamen im August 1813 französische Soldaten nach Česká Kamenice, forderten Lebensmittel und Futter und drohten, die Stadt niederzubrennen. Mitte September lagerten russische und preußische Truppen in der Region Děčín, die auch nach Česká Kamenice kamen und bis Ende Oktober in der Region blieben.
Im Jahr 1818 hatte Česká Kamenice 314 Häuser mit 2202 Einwohnern. Weitere 163 Häuser und 1020 Einwohner befanden sich in Horní und Dolní Kamenice. Die Anbindung der Stadt verbesserte sich in den Jahren 1816-1820 mit dem Bau der Reichsstraße über Křížový Buk nach Rumburk (Rumburg) erheblich. Im Jahre 1829 wurde auch die Straße nach Nový Bor (Haida) gebaut. In den Jahren 1826-1833 wurde die Straße nach Žandov (Sandau) gebaut. Die Straße nach Kunratice wurde erst 1843 fertiggestellt. Bereits 1741 wurde eine Postlinie von Lovosice (Lobositz) über Český Kamenice nach Rumburk eingerichtet. Im Jahr 1772 wurde in der Stadt eine Briefsammelstelle dokumentiert, die im Dezember 1832 zu einem eigenständigen Postamt wurde. Ab 1850 führte die Postlinie Děčín - Rumburk auch durch Český Kamenice.

Die älteste Preidlsche Spinnerei in der Mlýnská Straße.
Foto: Jiří Kühn.
Die erste Wollspinnerei und Strumpfwirkerei in der Stadt wurde 1830 von Karl Schiffner gegründet, weitere Spinnereien wurden von Josef Langer, C. V. E. Schwab und Franz Preidl, einem gebürtigen Haselr, errichtet. Daneben gab es 1843 drei weitere Tuchfärbereien, eine Tuchfabrik und fünf Glasbetriebe. Im Jahr 1840 wurde in Horní Kamenice auch eine Papierfabrik eröffnet.
Nach dem Revolutionsjahr 1848 wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und eine Verwaltungsreform durchgeführt, bei der die Gutsverwaltung abgeschafft und durch staatliche Behörden und kommunale Selbstverwaltung ersetzt wurde. Die Lockerung der Bedingungen erleichterte die für die Entwicklung der Industrie notwendige Freizügigkeit. Zu dieser Zeit hatte Česká Kamenice 321 Häuser mit 2344 Einwohnern.
Nach 1855 entstanden hier weitere Textilfabriken, von denen die wichtigste die Spinnerei von Franz Preidl in Rabštejnské údolí (Rabstein) war, die zwischen 1860 und 1867 errichtet wurde. Im Januar 1859 siedelte Florian Hübel aus Filipov seinen Betrieb zur Herstellung von Leinentüchern um, der später in eine Weberei umgewandelt wurde. Neben den Textilbetrieben wurden hier auch Textilmaschinenfabriken gegründet, von denen die Firmen von Josef Theodor Rochlitz und Adolf Renger bedeutend waren. Unter den Glasbetrieben entwickelte sich vor allem die Raffinerie von Franz Hegenbarth, 1871 die Firma A. Heide und Söhne und die Firma Ferdinand Hübsch, die Farben zum Bemalen von Glas und Porzellan herstellte.
Die Entwicklung der Industrie wurde durch die Eröffnung der Eisenbahnlinie von Děčín nach Varnsdorf (Warnsdorf) am 16. Januar 1869, mit der der Transport von Kohle in die Stadt begann, erheblich gefördert. Im Februar 1886 wurde die Nebenbahn von Česká Kamenice nach Kamenický Šenov (Steinschönau) eröffnet, der 1903 eine Lokalbahn über Mistrovice nach Česká Lípa (Böhmisch Leipa) folgte.
In der Stadt entstanden zahlreiche Vereine, von denen der 1856 auf Anregung von Robert Rochlitz als erster freiwilliger Feuerwehrverein in Böhmen gegründete Verein der Freiwilligen Feuerwehr von großer Bedeutung war. Der Schützenverein baute 1869 mit Hilfe des Fürsten Ferdinand Kinský einen neuen Schießstand, der zu einem der gesellschaftlichen Zentren der Stadt wurde. Der Deutsche Turnverein errichtete 1895 eine neue Turnhalle mit einem großen Saal und einer Gaststätte. Der am 24. April 1879 gegründete Verschönerungsverein bepflanzte die Kaiserallee oberhalb der Stadtbrauerei, legte einen großen Naturpark in der Nähe von Jehla (Nolde) an und trug auch zur Verschönerung des Schlosses Kamenický hrad (Kamnitz) bei, wo er einen Aussichtsturm und ein Restaurant errichtete. Auch der Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, dessen Sektion Böhmisch-Kamenitz 1890 gegründet wurde, sorgte für die touristische Erschließung attraktiver Orte in der Region.

Das Schulgebäude in der Palacký-Straße mit dem Schlossberg im Hintergrund.
Foto: Jiří Kühn.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Česká Kamenice nur eine Pfarrschule. Nach der Verkündung des neuen Schulgesetzes vom 21. April 1869 wurde in den alten Schulgebäuden in der Nähe der Kirche eine gemeinsame Schule für Jungen und Mädchen eingerichtet. Dank der Unterstützung von Franz Preidl wurde 1873 auch eine Berufsschule zur Ausbildung von Fachkräften für Textilfabriken eingerichtet. In den Jahren 1881-1883 wurde ein neues Schulgebäude in der heutigen Komenský Straße gebaut, in dem im September 1884 eine Knabenbürgerschule und 10 Jahre später eine Mädchenbürgerschule eröffnet wurde.
Noch vor Ende des 19. Jahrhunderts wurden in der Stadt die Kanalisation und die Wasserversorgung eingerichtet, danach wurden die Straßen nach und nach gepflastert. Das in den Jahren 1892-1894 errichtete Wasserversorgungssystem wurde aus einer Quelle in Střelnice gespeist und später um weitere Quellen an der Straße nach Liska erweitert. Im Juli 1895 wurde das städtische Schwimmbad an einem der Teiche oberhalb der Bürgerbrauerei umgebaut. Ab dem folgenden Jahr bis zum Ersten Weltkrieg wurde der Fluss Kamenice reguliert. In den Jahren 1900-1901 wurde in der Nähe des Bahnhofs ein städtisches Elektrizitätswerk gebaut. 1905 wurde die öffentliche Beleuchtung in Betrieb genommen, die die älteren Petroleumlampen ersetzte. Das neue Krankenhaus wurde am 6. Juli 1908 in Betrieb genommen. 1909-1911 wurde in der heutigen Palacký-Straße ein zweites Schulgebäude gebaut, in das die allgemeinbildende Knabenschule und die Bürgerschule einzogen, während die Mädchenschule im alten Gebäude blieb. Im Jahr 1919 wurde auch eine tschechische Schule in Česká Kamenice gegründet.

Ehemalige Textilfabrik in der Děčínská-Straße.
Foto: Jiří Kühn.

Ehemaliges städtisches Kraftwerk.
Foto: Jiří Kühn.
Im Jahr 1910 hatte Česká Kamenice 528 Häuser und erreichte mit 4723 Einwohnern seine höchste Einwohnerzahl. Zusammen mit Dolní und Horní Kamenice, Pekelský Důl, Filipov und Huníkov zählte es 925 Häuser und 7773 Einwohner. Die Entwicklung der Stadt wurde jedoch durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, in dem einige Unternehmen auf Kriegsproduktion umstellten und andere ihren Betrieb einstellen mussten. Wegen Kohlemangels wurde das städtische Elektrizitätswerk im Herbst 1916 stillgelegt, und im Juli 1917 wurde die Stadt an das Fernleitungsnetz der Nordböhmischen Elektrizitätswerke angeschlossen. Am 25. Juli 1924 wurde neben dem Eingang zur Marienkapelle ein Denkmal für 157 gefallene Bürger von Česká, Horní und Dolní Kamenice enthüllt.
Der Nachkriegsboom brachte eine Wiederbelebung der industriellen Produktion, doch 1929 brach die Weltwirtschaftskrise aus, die die Textilindustrie besonders hart traf. Die meisten Fabriken, darunter auch das größte Unternehmen Franz Preidl, mussten den Betrieb einstellen. Nur die Papierfabrik war praktisch noch eingeschränkt in Betrieb. Die Arbeitslosen arbeiteten zunächst in staatlich subventionierten Notarbeitsplätzen, waren aber später auf Armutsleistungen angewiesen.
Nach der Unterzeichnung des Münchner Abkommens am 29. September 1938 wurden die tschechischen Grenzgebiete von Deutschland übernommen. Česká Kamenice wurde am 3. Oktober 1938 besetzt. Am 6. Oktober besuchte Adolf Hitler die Stadt. Die Industrieunternehmen schlossen sich der nationalsozialistischen Wirtschaft an, die Arbeitslosigkeit wurde damit praktisch beendet. Die anfängliche Euphorie verflog jedoch bald, da die Naziverwaltung das kulturelle und politische Leben stark einschränkte. Im Herbst 1939 entfesselte Deutschland den 2. Weltkrieg, in dem 142 Männer aus Česká Kamenice getötet wurden.
Im Rahmen von Sparmaßnahmen wurde Česká Kamenice am 1. Juli 1943 mit Horní und Dolní Kamenice zu einer Gemeinde zusammengelegt. Der Mangel an Arbeitskräften in der Industrie wurde durch die Beschäftigung von Leuten aus befreundeten Ländern und von Arbeitskräften aus besiegten Nationen behoben. Ab 1942 wurden in mehreren Lagern in der Umgebung der Stadt auch Kriegsgefangene zur Arbeit eingesetzt. Als sich die Lage in Deutschland zuspitzte, wurde die Kriegsproduktion der Bremer Flugzeugfabrik Weser, die von alliierten Luftangriffen bedroht war, in die Spinnereien von Preidl im Rabštejn-Tal verlagert. Hunderte von Arbeitern kamen in die Stadt, für die in Rabštejn (Rabstein) ein Barackenlager eingerichtet wurde. Im Frühjahr 1944 wurde ein Großteil der Produktion unter die Erde verlegt. Einige Baracken des Lagers Rabštejn wurden in eine Außenstelle des Konzentrationslagers Flossenbürg umgewandelt.
Die Stadt blieb von den Kriegsoperationen praktisch unberührt. Die einzige Ausnahme war ein Luftangriff von 4 sowjetischen Flugzeugen am 8. Mai 1945, bei dem mehrere Häuser getroffen wurden. Am folgenden Tag traf das 1. Panzerkorps der 2. polnischen Armee von Brigadegeneral Josef Kimbar in Česká Kamenice ein.

Blick vom Turm der St.-Jakobs-Kirche über die obere Vorstadt zur Jehla (Nolde).
Foto: Jiří Kühn.
Bei Kriegsende lebten in Česká Kamenice mit Horní und Dolní Kamenice mehr als 6800 meist deutsche Einwohner, die nach dem Krieg zwangsumgesiedelt wurden. Neue tschechische und slowakische Siedler kamen in die Stadt, aber nur einige von ihnen ließen sich dauerhaft hier nieder. Am 15. Dezember 1946 waren in der Stadt 4418 Tschechen, 205 Deutsche und 74 Ausländer registriert. Im Juni 1946 wurde beschlossen, 18 Unternehmen zu erhalten, die übrigen sollten liquidiert werden. Auch zahlreiche Geschäfte, Gasthöfe und andere Gewerbebetriebe wurden geschlossen. Nach der kommunistischen Machtübernahme im Februar 1948 wurden alle privaten Unternehmen und Gewerbebetriebe geschlossen. Im Jahr 1949 wurde die JZD Huníkov gegründet, die sich später in zwei Teile aufspaltete, aber wegen anhaltender Probleme in der Verwaltung 1962 vom neu gegründeten staatlichen Landwirtschaftsbetrieb Česká Kamenice übernommen wurde.
Die unbewohnten Häuser der Stadt verfielen allmählich und einige von ihnen wurden später abgerissen. Darunter befanden sich auch die ursprünglichen Bäder im gotischen Stil und einige andere Gebäude von historischem Wert.
Am 1. Juni 1950 wurden Horní und Dolní Prysk und Vesnička (Füllerdörfel) nach Česká Kamenice eingemeindet, wurden aber 10 Jahre später wieder getrennt. Am 1. Juli 1980 wurden die Dörfer und Siedlungen Janská, Kerhartice, Kunratice, Lipnice (Limpach), Líska, Studený, Markvartice (Markersdorf), Srbská Kamenice (Windisch Kamnitz), Veselé und Kamenická Nová Víska Teil von Česká Kamenice. Nach der politischen Wende 1989 wurden die meisten der eingemeindeten Dörfer jedoch wieder unabhängig. Nur Líska und Kamenická Nová Víska blieben als Siedlungen von Česká Kamenice bestehen.
Ende September 1979 wurde der Personenverkehr auf der Strecke über Kamenický Šenov nach Česká Lípa eingestellt. Güterzüge fuhren bis Anfang der 1990er Jahre nach Kamenický Šenov. Im Zuge der Privatisierung der Industrie in den 1990er Jahren wurden die meisten Fabriken in der Stadt geschlossen. 2002 stellte auch die Papierfabrik in Horní Kamenice ihren Betrieb ein.
Denkmäler und Merkwürdigkeiten

Das südliche Stadttor mit dem Verbindungskorridor zwischen Kirche und Schloss. Links steht das wahrscheinlich älteste Steinhaus der Stadt.
Foto: Jiří Kühn.
Der historische Stadtkern entstand auf einer relativ kleinen Fläche am Fluss, wo der Nord-Süd-Landweg die lokale West-Ost-Verbindung mit Horní und Dolní Kamenice kreuzte. Da sich die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weiterentwickelt hat, wurde ihr Kern nicht wesentlich durch Abrisse oder Plattenbauten beeinträchtigt. Dank dessen hat sie ihren alten Charakter bis heute bewahrt. Am 10. September 1992 wurde die Stadt zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt, dessen Hauptwert neben der erhaltenen Innenstadt mit ihren engen Gassen und alten Häusern auch die markanten Wahrzeichen wie zwei Kirchen, ein Schloss und eine Reihe von Vorstadthäusern aus Holz sind.
Die Stadt war einst von einer Mauer mit vier Toren umgeben, von denen nur das südliche Schlosstor mit einem Stück der Mauer zwischen dem Schloss und der St.-Jakobs-Kirche erhalten geblieben ist. Das nördliche Tor (Kunersdorfer Tor) wurde bereits 1577 durch eine Überschwemmung zerstört, das obere (Steinschönauer) Tor wurde 1605 im Zuge der Stadterweiterung etwa 70 m weiter nach Osten verlegt und 1819 für Straßenumbauten abgerissen. Das gleiche Schicksal ereilte 1828 das Untere (Tetschener) Tor, das in der heutigen Dvořák-Straße stand.

Häuser mit dem Rathaus auf der Nordseite des Marktplatzes.
Foto: Jiří Kühn.
In der Stadt gibt es eine Reihe bemerkenswerter Häuser, die zum Teil aus dem 16. Jahrhundert stammen, aber größtenteils im 19. Jahrhundert umgebaut worden sind. An der Nordseite des Marktplatzes steht das zweigeschossige Rathaus mit niedrigem Dreiecksgiebel, das zwischen 1581 und 1582 von dem Zittauer Maurermeister Nicolaus Jäneck mit Hilfe des Baumeisters Peter Patzenhauer anstelle eines Renaissance-Bürgerhauses aus dem späten 15. Jahrhundert erbaut wurde. Im 18. Jahrhundert wurde das Gebäude um ein Geschoss aufgestockt. Beim spätklassizistischen Umbau von 1846-1847 wurde die Fassade mit Rustizierungen und der lateinischen Inschrift „Palladium civitatis“ (Stadtpatronat) am Eingangsportal verziert. Darüber befindet sich das Wartenberger Wappen mit der Jahreszahl 1591 und einer teilweise erhaltenen Inschrift, die an Heinrich von Wartenberg erinnert. Ab 1850 beherbergte das Gebäude verschiedene Ämter. Nach 1949 stand es leer und wurde von 1958-1967 als Museum genutzt. Später verfiel das ungenutzte Gebäude so sehr, dass es abgerissen werden sollte, aber 1992-1993 wurde es vollständig renoviert und wird heute wieder von der Gemeindeverwaltung genutzt.
An der Ecke links vom Rathaus steht ein barockes Stadthaus mit Mansarddach, das nach 1750 erbaut wurde und an dessen Giebel ein Relief eines sitzenden Hundes zu sehen ist. An der gegenüberliegenden Ecke befindet sich ein Doppelgiebelhaus, das nach 1843 durch den Wiederaufbau zweier älterer Häuser aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert entstanden ist. In den 1980er Jahren wurde jedoch ein großer Teil des Hauses abgerissen und als Replik wiederaufgebaut. Über den Fenstern, die der Ecke am nächsten liegen, befindet sich ein stilisiertes Schild mit einem Ankersymbol, den Initialen GH und der Jahreszahl 1800.
Die Ostseite des Platzes wird vom repräsentativen Hotel Slavie eingenommen, das an der Stelle eines alten Gasthofs aus dem Jahr 1620 errichtet wurde, der nach einem Brand am 21. Dezember 1895 durch das heutige Gebäude ersetzt und am 28. Januar 1897 eröffnet wurde. Bei diesem Brand wurde auch das Nachbarhaus Nr. 209 aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zerstört, in dem sich früher das Gasthaus „Zum blauen Löwen“ befand. Zwischen den Fenstern ist ein altes Hausschild mit der Jahreszahl 1579 und dem Text von Psalm 37,29 erhalten geblieben: "Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen."

Rekonstruierte Doppelhaushälfte an der Nordseite des Marktplatzes.
Foto: Jiří Kühn.

Das Hotel Slavie auf der Ostseite des Platzes.
Foto: Jiří Kühn.

Die Westseite des Platzes mit dem Gebäude der Stadtsparkasse.
Foto: Jiří Kühn.
Der westliche Teil des Platzes wird von dem prächtigen Neorenaissance-Gebäude der ehemaligen Stadtsparkasse beherrscht, die durch den Umbau eines älteren Bürgerhauses aus dem Jahr 1644 in den Jahren 1895-1897 entstanden ist. Die Hauptfassade mit einem Balkon im ersten Stock wird von einem reich gegliederten zweistöckigen Giebel mit einer Uhr und dem Stadtwappen gekrönt, flankiert von allegorischen Skulpturen der Industrie und des Handwerks. Die Spitze ist mit einer Statue des Ritters Ronald mit einer Wetterfahne und der Jahreszahl 1896 geschmückt. Die Innenräume sind ebenfalls reich verziert. Im ersten Stock befindet sich ein großer holzgetäfelter Raum mit einer Kassettendecke und originalen Leuchten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neben der Sparkasse beherbergte das Gebäude bis 1945 auch das Rathaus. In der Mitte der Häuserreihe neben der Sparkasse steht das zweistöckige Haus Nr. 270 aus der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts mit einer Empire-Fassade, an deren Eingangsportal ein stilisiertes Mondzeichen mit einem Gesicht angebracht ist, das an die Familie Luna aus Kamenice erinnert. Hinter der ehemaligen Sparkasse wächst eine monumentale, über 30 m hohe Esche mit einem Stammumfang von 468 cm, die auf ein Alter von 110 Jahren geschätzt wird.
An der Südseite des Platzes steht ein markantes Eckhaus aus der Zeit nach 1750 mit einem reich verzierten Giebel. Darin befindet sich heute ein Informationszentrum. Links davon befindet sich ein denkmalgeschütztes klassizistisches Haus mit Mansarddach, das 1825 umgebaut wurde. Interessant ist auch das alte zweistöckige Stadthaus Nr. 73 an der Ecke der zum Schloss führenden Straße, dessen Kern aus dem 15. und 16. Jahrhundert stammt. Das Haus besitzt eine erhaltene Arkade mit drei massiven Säulen und einem abgestuften Dachgiebel.

Gedenk-Esche hinter der Stadtsparkasse.
Foto: Jiří Kühn.

Informationszentrum an der Südseite des Marktes.
Foto: Jiří Kühn.

Ein Brunnen mit einer Statue der Jungfrau Maria.
Foto: Jiří Kühn.
In der Mitte des Platzes steht ein neunseitiger barocker Sandsteinbrunnen, der 1575 von Matthias Zimmermann aus Zittau errichtet wurde. In seiner Mitte steht eine polygonale Säule mit einer Statue der unbefleckten Jungfrau Maria aus dem Jahr 1680 vom Zittauer Meister Ulrich. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde in der Nähe des Brunnens ein hufeisenförmiger Quarzitstein in das Pflaster eingelassen, der zusammen mit anderen solchen Steinen den Bereich abgrenzte, in dem das Vieh während der Märkte zum Verkauf angeboten werden konnte. Bei der Rekonstruktion 1997-1998 wurde der Stein gefunden und in das Pflaster am westlichen Rand des inneren Bereichs des Platzes eingelassen.

Neorenaissance-Haus in der Janáček-Straße.
Foto: Jiří Kühn.

Jugendstilhaus aus dem Jahr 1909 auf dem Platz des 28. Oktober.
Foto: Jiří Kühn.
Auch in den angrenzenden Straßen finden sich wertvolle Bürgerhäuser. In der Janáček-Straße, östlich des Platzes, steht das Neorenaissance-Haus Nr. 204 aus dem Jahr 1896 mit einer reich verzierten Fassade, die in einem Treppengiebel und einem Erker an der Rückwand gipfelt, während sich an der Nordseite des Platzes des 28. Oktober ein interessantes Jugendstil-Haus Nr. 177 aus dem Jahr 1909 befindet. Auf dem Haus Nr. 61 in der Mlýnská-Straße, wo Franz Preidl 1843 seine erste Baumwollspinnerei gründete, steht eine Statue des Heiligen Johannes von Nepomuk.
In der Lipová-Straße unterhalb des Burgtors steht das wahrscheinlich älteste Steinhaus Nr. 107 aus dem 15. Jahrhundert. In der Villa Nr. 103 etwa 70 m oberhalb der Kirche befindet sich das Schreibmaschinenmuseum. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich ein historisch wertvolles zweistöckiges Fachwerkhaus aus den 1750er Jahren, das nach dem Zweiten Weltkrieg baufällig wurde und zum Abriss vorgesehen war. Im Sommer 2000 demontierte es der Verein Kampanila und wollte es in Chřibská (Kreibitz) wieder aufbauen, aber es konnte kein geeigneter Platz dafür gefunden werden, so dass das Haus nicht wieder aufgebaut werden konnte.

Denkmalgeschütztes Haus mit Fachwerkboden in der Žižkova-Straße.
Foto: Jiří Kühn.
In den Außenbezirken der Stadt sind noch mehrere typische Fachwerkhäuser mit Umgebinde aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert erhalten. Dazu gehören z. B. das Fachwerkhaus Nr. 308 mit Fachwerkboden und Mansarddach in der Nerudova-Straße, das Haus Nr. 229 mit einer Fachwerkstube, einem Umgebinde und einem Fachwerkboden in der Žižkova-Straße oder das zweigeschossige Fachwerkhaus mit Türsturz, einem Steinportal und einem Mansarddach in der Dívčí-Straße Nr. 385.
An der Giebelwand des Hauses Nr. 241 in der Nähe der Marienkapelle wurde vor 1920 von dem Uhrmacher und Optiker Adolf Eiselt eine mechanische astronomische Uhr mit geschnitzten Apostel- und Handwerkerfiguren angebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg kümmerte sich jedoch niemand um sie und sie verschwand allmählich. Im November 2023 begann die Stadt, die Fassade des Hauses zu reparieren und die Uhr zu restaurieren, wozu viele Bürger in einer öffentlichen Sammlung beitrugen. Die neuen Figuren aus bemaltem Glas und Metall wurden in der Glasfachschule in Kamenický Šenov hergestellt, und die restaurierte astronomische Uhr wurde an Ostern, dem 31. März 2024, enthüllt. Sie ist tagsüber zu jeder vollen Stunde zu besichtigen.

Das Haus mit einer astronomischen Uhr in der Nähe der Marienkapelle.
Foto: Jiří Kühn.

Blick auf die St. Jakobskirche von der Südostseite.
Foto: Jiří Kühn.
An der Südseite des Stadtzentrums steht die Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere, deren Fundamente auf das 14. Jahrhundert zurückgehen. 1444 wurde die ursprüngliche Kirche von den Lausitzern niedergebrannt, aber bald darauf wieder aufgebaut und 1562 noch einmal umgebaut. Der bedeutendste Umbau im spätgotischen Stil wurde 1604-1605 von dem Steinmetz Peter Patzenhauer durchgeführt. Aus dieser Zeit stammt das heutige dreischiffige Gebäude mit einem Netzgewölbe, das auf achteckigen Pfeilern zusammenläuft und in einem fünfeckigen Altarraum endet. Um 1607 wurden im östlichen Teil des Kirchenschiffs steinerne Seitentribünen mit Blindarkaden und Puttenköpfen eingebaut, die mit Wappen mit Bibelzitaten und Gedenkinschriften verziert sind. An der Westseite des Kirchenschiffs befindet sich ein zweigeschossiger Chor, der von vier Säulen getragen wird. An der Brüstung seines Untergeschosses befinden sich neun plastische Wappen der Vorfahren Johanns von Wartenberg, die der Meißner Steinmetz Valentin Wollde geschaffen hat. Es handelt sich um die Wappenschilde der ritterlichen Familien der Michalovits, Wartenbergs, Schönfelds, Salhausens und der mit Wartenberg verwandten Coreths, Kolowrats, Schlicks und den Herren von Weitmühl. Im oberen Barockgeschoss des Chors befindet sich die 1754 vom Zittauer Organisten Johann Gottlieb Tamitius erbaute Orgel, die hundert Jahre später auch vom jungen Antonín Dvořák gespielt wurde, als er sich hier aufhielt, um sein Deutsch zu verbessern.

Die St. Jakobskirche mit ihrem massiven Turm und dem Verbindungsgang zum Schloss.
Foto: Jiří Kühn.
Das ursprüngliche gotische Eingangsportal, das bei der Vergrößerung der Kirche im Jahr 1605 teilweise zugemauert wurde, ist im kreuzverglasten Eingangsbereich erhalten geblieben. An der Südwestecke der Kirche steht ein 46 m hoher viereckiger Turm mit einer Empore, der 1552-1555 von dem örtlichen Baumeister Veit Seiffert errichtet wurde. Ursprünglich sollte er als Wachturm Teil der Stadtbefestigung sein und wurde beim Wiederaufbau 1605 an die Kirche angebaut. Im Jahr 1792 wurde die Kirche durch einen erhöhten, überdachten Gang mit dem benachbarten Schloss verbunden, in dem seit 2002 eine Ausstellung über die Geschichte der Stadt untergebracht ist.

Das Innere der St. Jakobus-Kirche.
Foto: Jiří Kühn.
Das Innere der Kirche stammt hauptsächlich aus dem 18. Jahrhundert. Der klassizistische Säulen-Hauptaltar vom Ende des 18. Jahrhunderts trägt ein Gemälde der Enthauptung des heiligen Jakobus aus dem Jahr 1797 des Malers Dominik Kindermann aus Šluknov (Schluckenau). Aus der gleichen Zeit stammen die Kanzel und zwei klassizistische Seitenaltäre des Heiligsten Herzens des Herrn und der Jungfrau Maria, die vom Tischler Richter angefertigt und von Anton Max geschnitzt wurden. Auf den Konsolen befinden sich eine Rokokostatue der Jungfrau Maria unter dem Kreuz, eine Pieta und Statuen des Heiligen Thomas, des Heiligen Antonius, des Heiligen Andreas, des Heiligen Johannes von Nepomuk, des Heiligen Laurentius und des Heiligen Florian. Außerdem gibt es ein Gemälde der Jungfrau Maria aus dem Jahr 1762, ein Gemälde des Heiligen Johannes des Täufers aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und das geschnitzte barocke Taufbecken aus dem 2. Viertel des 18. Jahrhunderts sind ebenfalls interessant.
Am Gewölbe des Altarraums befinden sich bemerkenswerte Wandmalereien des Malers Abraham Kitzinger aus der Zeit vor 1610, die die biblische Szene der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor mit der Taube, Moses, Elias und den Aposteln Jakobus, Johannes und Petrus darstellen. Wunderschön sind auch die gemalten Fenster mit der Darstellung des Herzens Jesu und des Herzens Mariens, die der Glasmacher Valentin Schürer aus Falknov (Falkenau) der Kirche geschenkt hat.
Zahlreiche Grabsteine, meist aus dem 16. und 17. Jahrhundert, sind in die Innenwände der Kirche eingelassen. Unter ihnen sticht das massive Marmorepitaph des Christoph von Wartenberg († 1537) des Dresdner Bildhauers Walter hervor. Das Relief, das einen knienden Ritter mit dem Familienwappen und einer Inschriftentafel darstellt, gehört zu den schönsten Renaissance-Grabmälern des 16. Jahrhunderts. Unter der Kanzel befindet sich ein Renaissance-Grabstein des 1558 verstorbenen Gutsherrn Sigismund von Schönfeld und der Grabstein des 1582 verstorbenen Johann von Schönfeld. In der Nähe des nordwestlichen Eingangs befindet sich auch der Grabstein des Kirchenbaumeisters und Bürgermeisters Peter Patzenhauer, der am 23. Juli 1611 starb. In der unzugänglichen Krypta der Kirche befinden sich 8 Zinn- oder Kupfersärge mit den sterblichen Überresten der Herren von Wartenberg.
In den Jahren 1992-2001 wurde die Kirche umfassend renoviert. Im Jahre 1993 wurde eine neue Uhr im Turm installiert. Von der Galerie des Turms hat man einen schönen Blick auf die Stadt und ihre unmittelbare Umgebung.
Eine Sandsteintreppe führt von der Stadt zur Kirche, über der einst die Statuen des Heiligen Johannes von Nepomuk und des Heiligen Antonius standen, die in den 1880er Jahren in den neu gestalteten Brüderaltar unter der Jehla (Nolde) versetzt wurden. Ihre Torsi befinden sich heute im Atrium der Marienkapelle.

Das Dekanatsgebäude hinter der Kirche. Links davon befindet sich die alte Schule.
Foto: Jiří Kühn.

Die geschützte Eibe hinter der St. Jakobuskirche.
Foto: Jiří Kühn.
Ursprünglich gab es rund um die Kirche einen Friedhof, von dem nur drei Grabsteine vom Anfang des 17. Jahrhunderts erhalten sind, die in die Ostwand der Kirche eingelassen sind. Im Jahr 1643 wurde am nördlichen Rand der Stadt ein neuer Friedhof angelegt, neben dem später die Marienkapelle errichtet wurde. Nachdem die Mauer des alten Friedhofs 1833 abgerissen wurde, entstand hinter der Kirche der heutige Jakubské náměstí (Jakobsplatz), wo sich das denkmalgeschützte zweistöckige Gebäude der Pfarrschule Nr. 111 befindet, das laut der Inschrift auf der Steinplatte über den Fenstern im Jahr 1562 erbaut wurde. Ursprünglich ein Renaissance-Haus, wurde es später mehrfach umgebaut und bis 1883 für den Unterricht genutzt. Neben der Schule wurde 1570 vom örtlichen Baumeister Stephan Patzenhauer ein Pfarrhaus erbaut, in dem heute das Dekanat untergebracht ist. Im benachbarten Garten wächst eine geschützte, etwa 7 m hohe Roteibe, die auf ein Alter von 200 Jahren geschätzt wird. Der Baum sollte um 1900 gefällt werden, aber dank des Einsatzes des Nordböhmischen Excursionsclubs von Česká Lípa ist er bis heute erhalten geblieben.

Blick auf das Schloss vom Turm der Jakobskirche aus.
Foto: Petr Kühn ml.
Gegenüber der Kirche steht ein vierflügeliges Renaissanceschloss mit Innenhof, das in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts von den Wartenbergs an der Stelle des alten Meierhofs errichtet wurde. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde es instand gesetzt und diente seitdem der Verwaltung des Gutes. Nach 1945 war das Schloss Sitz des Forstbetriebes Česká Kamenice, 1977-1993 wurde es vom staatlichen Landwirtschaftsbetrieb genutzt. Heute ist es in Privatbesitz. Der älteste Teil des Schlosses ist ein großes zweistöckiges Gebäude an der Westseite, das später mehrfach umgebaut wurde. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts fügte Wilhelm Kinský einen separaten südlichen Flügel hinzu, der im Erdgeschoss und im ersten Stock durch vier Säulenarkaden im Renaissancestil gegliedert ist und in den Jahren 1847-1849 vom Maurermeister Ignaz Dittrich im klassizistischen Stil umgebaut wurde. Die Nordseite des Hofes wird von zwei kleineren zweigeschossigen Gebäuden umschlossen, von denen eines mit einem steinernen Eingangsportal mit der Jahreszahl 1796 verziert ist. Über dem Eingangstor an der Ostseite des Schlosses befindet sich ein Stein mit einer Inschrift und den Wappen von Wilhelm Kinský und seiner Frau Elisabeth Trčka aus dem Jahr 1631.

Die Kotouč-Brauerei.
Foto: Jiří Kühn.
In den Jahren 1718-1723 wurde hinter dem Schloss ein großer Wirtschaftshof errichtet, woraufhin Graf Kinský dort eine Brauerei und Brennerei errichten ließ. Diese brannte jedoch 1758 oder 1759 ab. Ihr Wiederaufbau dauerte bis 1761. In den Jahren 1780-1783 wurde hier nach den Plänen des Architekten Jan Wenzel Kosch aus Děčín eine neue Brauerei mit Kellern und einer Mälzerei errichtet, die in späteren Jahren weiter ausgebaut wurde. Dazu gehörte auch ein barockes Wohnhaus für die Angestellten, das 1712 westlich des Schlosses errichtet wurde und dessen Fassade das Kinský-Wappen trägt. Die Bierproduktion wurde 1951 eingestellt. Die Gebäude verfielen langsam, bis 2013 der neue Eigentümer Jan Kotouč mit der Renovierung begann. Am 10. Dezember 2015 wurde das Bierbrauen wieder aufgenommen. Die Brauerei ist ein technisches Denkmal und ein interessantes Beispiel für Industriearchitektur. Außerdem gibt es eine Gaststätte mit einem Brauereiladen, eine Pizzeria, eine Brennerei und eine Apfelweinkelterei.

Salhausener Schloss.
Foto: Jiří Kühn.
Im westlichen Teil der Stadt, nahe der Straße nach Janská, steht das spätgotische zweigeschossige Salhausener Schloss Nr. 35 mit quadratischem Eckturm und Treppengiebeln. Es wurde wahrscheinlich 1521 von Hans von Salhausen erbaut. Um 1541 wurde das Stadtspital der Heiligen Dreifaltigkeit in das Schloss verlegt. Von 1871 bis 1907 diente das Schloss als Krankenhaus. Im Jahr 1908 richtete der Archivar und Bürgermeister Gustav Nowak das Stadtmuseum ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Museum im Mai 1948 wiedereröffnet, 1958 wurde es in das heutige Rathaus verlegt und 1967 geschlossen. In der Nähe des Schlosses steht das ehemalige Armenhaus Nr. 350, das 1871 auf Initiative von Dekan Augustin Zippe und auf Kosten des Textilindustriellen Franz Preidl errichtet wurde. Das Armenhaus wurde am 17. September 1872 in Betrieb genommen und ist heute der Sitz der katholischen Caritas. Das nach den Plänen von Ignaz Ullmann errichtete zweigeschossige neugotische Haus mit gestuften Seitengiebeln hat sein ursprüngliches Aussehen bewahrt. Seine Fassade wird durch ein Eingangsportal mit einer doppelten Steintreppe hervorgehoben Im Stockwerk darüber befindet sich ein großes gebrochenes Kapellenfenster mit der Aufschrift „Haus der Heiligen Familie“ auf der Fensterbank. In der Vorhalle befindet sich eine marmorne Gedenktafel mit dem Emblem von Böhmisch Kamnitz und dem Dank an den Stifter Franz Preidl.

Das ehemalige Armenhaus ist heute der Sitz der Caritas.
Foto: Jiří Kühn.

Blick auf die Marienkapelle vom ehemaligen Friedhof aus.
Foto: Jiří Kühn.
Im nördlichen Teil der Stadt steht die barocke Wallfahrtskapelle Mariä Geburt, die dank ihrer schönen bildhauerischen und malerischen Ausschmückung zu den schönsten Denkmälern der Gegend gehört. Sie wurde von Dekan Heinrich Ignaz Teigel erbaut, in dessen Zeit sich hier der Kult der Muttergottes von Kamenice verbreitete. Der Volksüberlieferung zufolge wurde ihre Statue 1680 für den Marienaltar in der St.-Jakobus-Kirche angefertigt, doch nach 1706 wurde sie in der Holzkapelle auf dem Stadtfriedhof aufgestellt. Als Dekan Teigel 1714 an der Pest erkrankte, betete er zur Jungfrau Maria und ließ nach seiner Genesung zum Dank einen neuen Rokoko-Altar für die Statue errichten. Die Nachricht von der wundertätigen Statue verbreitete sich schnell. Pilger aus der ganzen Umgebung kamen in die Stadt. Dekan Teigel sammelte daher nach und nach Geld für ein größeres Heiligtum, dessen Fertigstellung er jedoch nicht mehr erlebte, da er 1735 starb.
Die neue Kapelle wurde von Jakub Schwarz nach den Plänen von Octavio Broggio, einem bekannten Baumeister aus Litoměřice, errichtet. Der Grundstein wurde 1736 gelegt. Die Kapelle wurde am 5. September 1739 eingeweiht. Später baute Jan Jiří Kačinka einen Vierflügelambus um die Kapelle, der 1749 fertiggestellt wurde, wie die Jahreszahl am Eingangsturm zeigt. Die Ausstattung der Eckkapellen zog sich jedoch in die Länge, so dass der gesamte Bereich erst 1763 geweiht wurde.

Der Kreuzgang im Vorraum der Kapelle.
Foto: Jiří Kühn.
Die zentrale runde Kapelle mit einer massiven Kuppel wird von einer Laterne mit einem Zwiebeldach überragt und ist von einer unteren Galerie umgeben. An der Südost- und Nordwestseite befinden sich markante Eingangsstrebepfeiler, zwischen denen sich in regelmäßigen Abständen konkav gewölbte Strebepfeiler mit korinthischen Kapitellen befinden. Das Gebäude ist mit 24 Sandsteinskulpturen geschmückt, die wahrscheinlich aus der Werkstatt des Markersdorfer Bildhauers Johann Wenzel Füger stammen, der ein Schüler des bedeutenden Prager Barockbildhauers Ferdinand Maximilian Brokoff war. Auf den Eingangsstrebepfeilern befinden sich Statuen der Jungfrau Maria und des heiligen Josef mit dem von Engelspaaren umgebenen Jesuskind, auf dem profilierten Kranzgesims Statuen der heiligen Petrus und Paulus, der heiligen Anna, Johannes des Täufers und vier weiterer Heiliger und auf der unteren Empore Statuen der Evangelisten Johannes, Lukas, Markus und Matthäus sowie der vier Kirchenväter Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und Gregor des Großen.
Die Kapelle ist von einem vierflügeligen Kreuzgang mit kleineren Eckkapellen und einem zweistöckigen Eingangsturm mit Glockenturm umgeben, der von einem Zwiebelerker mit Laterne bedeckt ist. Im Erdgeschoss des Turms befindet sich ein profiliertes Eingangsportal mit einem stilisierten Herz und der Jahreszahl der Erbauung. Über dem Bogen des Gesimses ist eine Nische mit einer Statue der Muttergottes von Kamenice mit dem Jesuskind. Die Flügel des Kreuzgangs sind durch Arkaden nach innen geöffnet und vier kurze Arkadengänge münden in der zentralen Kapelle.

Die Kuppelverzierung der Marienkapelle.
Foto: Jiří Kühn.
In den Jahren 1883-1885 wurde die Marienkapelle auf Kosten des Textilindustriellen und Bürgermeisters Franz Preidl umfangreich renoviert und am 29. Juni 1885 neu eingeweiht. Die Inschrift auf der Gedenktafel an der linken Seite des Kapelleneingangs erinnert noch heute an die Verdienste von Franz Preidl. Bei der Renovierung wurde der Innenraum reich mit Gemälden und Stuck verziert, das Gewölbe der Kuppel mit prächtigen Fresken aus dem Leben der Jungfrau Maria und der Offenbarung des Herrn von Ferdinando Brunetti sowie mit Glasfenstern, die die Jungfrau mit Kind, die Himmelfahrt Jesu Christi und die Anbetung der Heiligen Drei Könige darstellen.

Blick auf das Innere der Kapelle mit der Rückseite des Hauptaltars.
Foto: Jiří Kühn.
In der Mitte der Kapelle steht ein vierseitiger Rokoko-Hauptaltar aus dem Jahr 1746 des Prager Bildhauers Johann Josef Klein mit einer vergoldeten Holzstatue der Muttergottes von Kamenice, die vermutlich 1680 von dem Bildhauer und Schnitzer Christian Ulrich aus Zittau geschnitzt wurde. Auf der linken Seite des Altars befindet sich eine kleinere Pilgerstatue der Jungfrau Maria aus dem Jahr 1835, die 2008 in einer der Häuser in Studený gefunden wurde. Die Rückseite des Altars ist mit einem Gemälde der Muttergottes von Kamenice in einem Seidenkleid geschmückt.
In der linken Seitenkapelle befindet sich ein Altar des Schutzpatrons von Preidl, des hl. Franz Xaver, und in der rechten Kapelle ein Altar des hl. Alois von J. Lampel aus Prag, der 1750 von dem Böhmisch Kamnitzer Maler F. Knechtel verziert wurde. Bemerkenswert ist auch die barocke Kanzel aus dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts von dem Bildhauer Josef Max aus Sloup (Bürgstein). Im Chor steht leider eine nicht funktionierende Orgel der österreichischen Firma Matthäus Mauracher aus dem Jahr 1917.

Der Hauptaltar mit der Statue der Muttergottes von Kamenice.
Foto: Jiří Kühn.

Der Altar des hl. Johannes von Nepomuk in einer der Eckkapellen des Kreuzganges.
Foto: Jiří Kühn.

Der Eingangsturm des Wallfahrtsbereichs der Marienkapelle.
Foto: Jiří Kühn.
In der östlichen Kapelle des Kreuzgangs befindet sich ein Barockaltar mit einer Statue des heiligen Antonius von Padua vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die nördliche Kapelle ist mit einem Altar aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts mit einem Rokoko-Gemälde des heiligen Johannes von Nepomuk aus dem Jahr 1826 des Děčiner Malers Franz Hochelber und Statuen des heiligen Rochus und Sebastian geschmückt. In der westlichen Kapelle befindet sich ein Rokokoaltar der Heiligen Familie und in der südlichen Kapelle ein Marienaltar. Im Kreuzgang befinden sich mehrere Epitaphien und Gedenktafeln aus dem geschlossenen Friedhof, eine Rokokostatue des heiligen Thaddäus, umgeben von Danksagungstafeln, eine Kreuzigungsgruppe mit der Jungfrau Maria und dem heiligen Johannes, ein Pestwagen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Torsi der Statuen des Todesengels, des heiligen Johannes von Nepomuk und des heiligen Antonius von Padua, die vom Brüderaltar unter der Jehla (Nolde) hierher gebracht wurden.
Der Zugang zum Gelände der Wallfahrtskapelle wird seit 1813 von einer Lindenallee gesäumt, die im April 2021 durch neue Bäume ersetzt wurde. Der Weg beginnt mit einigen Stufen mit Sandsteingeländer, auf denen früher Steinstatuen des Heiligen Johannes von Nepomuk und des Heiligen Vitus standen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an einen unbekannten Ort gebracht wurden. In dem kleinen Park links vom Eingangsturm befindet sich ein Denkmal für 157 Opfer des Ersten Weltkriegs, das am 25. Juli 1924 eingeweiht wurde und an dem heute die Tafeln mit den Namen der Gefallenen fehlen. An ihrer Stelle befindet sich lediglich eine kleine Granitplatte mit einer allgemeinen Widmung für alle Kriegsopfer.

Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Foto: Jiří Kühn.

Park an der Stelle des ehemaligen Friedhofs.
Foto: Jiří Kühn.

Begräbniskapelle der Familie Preidl.
Foto: Jiří Kühn.
An der Westseite grenzt der von einer Steinmauer umgebene Franz-Preidl-Park an die Marienkapelle. Seit 1643 gibt es hier einen städtischen Friedhof, der den ursprünglichen Friedhof bei der Jakobskirche ersetzte. Er wurde um 1850 vergrößert, aber 1922 geschlossen und ein neuer Friedhof am nordwestlichen Rand der Stadt an der Straße nach Filipov angelegt. Vom Friedhof bei der Marienkapelle ist heute nur noch die am 17. August 1868 eingeweihte Grabkapelle der Familie Preidl erhalten. Das sechsseitige Backsteingebäude am südlichen Rand des Parks wird von einem Tambour mit einer Kuppel und einer schlanken Steinsäule mit Turmspitze gekrönt. Seine Wände werden oben von einem verzierten Gesims flankiert und an den Ecken durch polygonale Pfeiler getrennt. Das Eingangsportal ist mit einer halbrunden Archivolte mit geometrischem Muster und einem Relief des Antlitzes Christi verziert. An den angrenzenden Wänden befinden sich Nischen mit den Statuen des Heiligen Petrus und Jesus Christus, der als Gärtner mit Spaten dargestellt ist. Leider wurde das Innere der Kapelle in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerstört.
Am 24. Oktober 1948 wurde in der Mitte des Parks ein opulentes Denkmal für die Rote Armee enthüllt, das von dem Stadtarchitekten František Budka entworfen wurde. Das Denkmal wurde jedoch später wieder entfernt, und sein Hauptteil aus Sandstein steht jetzt an der Nordseite des Parks. In den Jahren 2019-2021 wurde der Park erheblich umgestaltet und mit neuen Bäumen und Sträuchern bepflanzt. An der Westmauer befindet sich ein Wasserbecken aus Sandstein, und an der Nordmauer in der Nähe der Marienkapelle wurde im Juni 2021 auf Veranlassung der Vereinigung der deutschen Verbände in der Tschechischen Republik eine Gedenktafel angebracht, die daran erinnert, dass dies die letzte Ruhestätte der ehemaligen Einwohner der Stadt ist.

Das barocke ehemalige Armenhaus.
Foto: Jiří Kühn.
Nordöstlich der Marienkapelle steht das ehemalige Krankenhaus Nr. 243, das Graf Philipp Josef Kinský in seinem Testament von 1741 verfügte. Sein Sohn Franz Ulrich betraute Jakub Schwarz mit dem Bau, der von Jan Jiří Kačinka unterstützt wurde. Die Bauarbeiten begannen nach 1749, 2 Jahre später war der Rohbau fertiggestellt und am 25. März 1753 wurde das Haus in den Dienst der Hospitaliter gestellt. Das zweistöckige Barockgebäude mit Mansarddach und Dachgauben in Form von Ochsenaugen trägt über dem steinernen Eingangsportal ein plastisches Wappen der Familie Kinský mit einer belaubten Grafenkrone. Das Innere war durch hölzerne Trennwände in 24 Kammern unterteilt, zwischen denen sich ein breiter Korridor mit einem Kachelofen befand. Die großen Säle im Erdgeschoss und im ersten Stock haben noch die ursprüngliche Balkendecke. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Krankenhaus in eine Fabrik umgewandelt. Kriegsgefangene wurden hier untergebracht. In den 1950er Jahren wurde es in ein Kulturhaus umgewandelt und nach 1983 zog das Restaurant Starý klub hier ein. Auf dem Gelände neben dem Krankenhaus wurde ein Denkmal für die Opfer der Pockenepidemie von 1778 aus mehreren Basaltsäulen errichtet, von dem heute jedoch nur noch kleine Reste erhalten sind.

Evangelische Kirche.
Foto: Jiří Kühn.
Etwa 200 m westlich davon steht die ehemalige evangelische Jesus-Christus-Kirche, erbaut nach den Plänen des Architekten Hermann Gerhard aus Görlitz, modifiziert von Ernst Wutschke aus Podmokly (Bodenbach). Der Grundstein wurde am 28. Oktober 1929 gelegt und die Kirche am 10. August 1930 eingeweiht. Der einschiffige rechteckige Bau mit einem rechteckigen Altarraum und einem quadratischen Turm mit Glockendach war ursprünglich mit Glasfenstern mit religiösen Motiven des Glasmalers Franz Tschörner geschmückt. Im Inneren befand sich auch ein bemerkenswertes Taufbecken aus Kristallglas. Nach 1945 wurde die Kirche von der evangelischen Kirche genutzt und verfiel allmählich, bis die Stadt 1968 mit dem Wiederaufbau begann und 1980 eine Trauerfeierhalle einrichtete.

Ehemalige Turnhalle.
Foto: Jiří Kühn.
Auf der Nordseite des Stadtzentrums, am Fluss, steht ein prächtiges ehemaliges Turnhallengebäude aus den Jahren 1895-1896, das heute als Gymnasium und Kulturhaus genutzt wird. Daneben steht ein älteres Schulgebäude aus den Jahren 1881-1883, und in der Palackého-Straße wurde 1909-1911 eine neue Schule nach den Plänen des örtlichen Baumeisters Josef Weinolt errichtet. Beide Schulen wurden dank der Stiftung des Ehepaars Theresia und Franz Schneider gebaut und erfüllen noch heute ihren Zweck. In der 5. května-Straße wurde 1903-1908 unter der Leitung von Josef Weinolt auch ein Krankenhaus gebaut, dessen Gebäude 1937-1938 erweitert und 1995 in ein Krankenhaus für Langzeitpatienten umgewandelt wurde.
Am Stadtrand unterhalb der Jehla (Nolde) wurde in den Jahren 1868-1869 mit finanzieller Hilfe von Ferdinand Kinský ein klassizistisches Gebäude mit Schießstand und Festsaal errichtet, das ein älteres Gebäude aus dem Jahr 1731 ersetzte. 1930 wurde es an der Ostseite um einen großen Hotelanbau erweitert. Das Hotel blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen, wurde aber später in ein Genesungsheim und schließlich in ein Altersheim umgewandelt, das sich auch heute noch dort befindet. Auf der Wiese hinter dem Gebäude ist der Grundpfeiler der Schießanlage mit den Jahreszahlen 1720-1884 an der Seite erhalten. Neben dem Schießstand wurde 1932 in einem kleinen Park mit einem Wasserwerk ein Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitglieder des Schützenvereins errichtet, von dem heute jedoch nur noch ein Torso übrig ist.

Das Gebäude des ehemaligen Sitzes der Preidl'schen Spinnerei ist heute ein Kinder- und Jugendhaus.
Foto: Jiří Kühn.
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurden in der Stadt mehrere prächtige Villen von lokalen Fabrikanten und Kaufleuten gebaut. Die größte Villa, Nr. 491, wurde in den Jahren 1895-1896 von Franz Karsch, dem Besitzer der Rabštejner Spinnereien, am Hang oberhalb der Komenský-Straße erbaut. Das zweigeschossige Gebäude mit einem Turm und einem großen Wintergarten, der 1908 angebaut wurde, wurde in den 1930er Jahren modern umgebaut und verlor seine historistische Ausstattung. Heute beherbergt es ein Kinderheim. Die bemerkenswerte historistische Einrichtung wurde ebenfalls 1894 von dem Fabrikanten Emanuel Karsch am Hauptgebäude der Spinnerei in der Dukelských hrdinů-Straße 328 geschaffen, wo sich heute das Kinder- und Jugendzentrum befindet. Die reich verzierte Fassade hat einen bogenförmigen Balkon, der von Säulen mit allegorischen Skulpturen der Industrie und des Handels getragen wird, und einen achteckigen verglasten Wintergarten, der an der Westwand des Gebäudes angebracht ist. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, etwa 100 m weiter, steht die markante Jugendstilvilla Nr. 530, die in den Jahren 1904-1905 von Franz Knappe, dem Besitzer der Spinnerei in Dolní Kamenice (Niederkamnitz), errichtet wurde.
In der Mácha-Straße, am Hang unterhalb der Jehla, befindet sich ein Trio von Jugendstilvillen des böhmisch kamnitzer Baumeisters Josef Weinolt. Weinolt selbst errichtete 1897-1899 die zweigeschossige Ausstellungsvilla Nr. 513 mit Mansarddach und einem zweigeschossigen Eckturm auf der Nordseite der Straße. Etwas höher liegt die Villa Nr. 301, die 1907-1908 als Mietshaus für den Kaufmann Franz Matzke errichtet wurde. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich die Villa Nr. 311 der Familie Heide aus dem Jahr 1908. In der Straße Na Vyhlídce, neben dem ehemaligen Schießstand, versteckt sich in einem großen Garten die Villa von Franz Nožička aus dem Jahr 1932 von den bekannten Architekten Ernst Mühlstein und Victor Fürth.

Weinolts Villa in der Mácha Straße.
Foto: Jiří Kühn.

Villa der Familie Heide in der Mácha Straße.
Foto: Jiří Kühn.
Im westlichen Teil der Stadt an der Straße nach Filipov steht die Villa Nr. 320, die 1904 für den Besitzer der Glashütte Josef Dörre gebaut wurde. In der Děčínská-Straße finden wir die Ausstellungsvilla Nr. 354, die Franz Pilz in der Nähe seiner Spinnerei errichten ließ. Südöstlich des Stadtzentrums, an der Kreuzung der Hauptstraße mit der Palackého-Straße, befindet sich die moderne neoklassizistische Villa Nr. 141, die in den Jahren 1922-1923 für den Textilfabrikanten Rudolf Hübel erbaut wurde und heute einen Kindergarten beherbergt. Das Gebäude ist mit zahlreichen architektonischen Details im Art-déco-Stil verziert. Wertvoll sind auch die Stuckverzierungen an den Decken, die Holzvertäfelung der Innenwände, das Treppenhaus und die Einbaumöbel.

Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit an der Straße nach Huníkov.
Foto: Jiří Kühn.
Erwähnenswert sind die Villen Nr. 488 und 489 aus dem Jahr 1894, die hinter dem Bahnübergang an der Straße nach Huníkov stehen. Etwa 100 m südlich von ihnen, auf der linken Seite der Straße, steht eine kleine Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit, die 1694 von Christian Luna erbaut wurde. Der Überlieferung nach stand hier bereits im 15. Jahrhundert eine Kapelle, an deren Stelle 1621 oder 1676 eine Säule mit einer Statue der Heiligen Barbara errichtet werden sollte. Die heutige Barockkapelle mit einem Relief der Krönung der Jungfrau Maria in der Nische wird von einem Dach mit zwei Sandsteinkegeln und einem viereckigen Sandsteinturm mit einer Statue der Heiligen Barbara und einem Kreuz auf der Spitze bedeckt. Die Kapelle wurde 1996-1997 renoviert und am 19. September 1998 wieder eingeweiht. Etwa 1 km entfernt befindet sich eine neuere Backsteinkapelle, die wahrscheinlich aus dem späten 18. Jahrhundert stammt und im 19. Jahrhundert umgebaut wurde. An der Rückseite befindet sich ein etwas schmalerer zweistöckiger Glockenturm.

Der Kugelbrunnen an der Grenze von drei Landschaftsschutzgebieten.
Foto: Jiří Kühn.
Ein interessantes Denkmal befindet sich westlich des Platzes an der Kreuzung der Smetana- und der Dvořákova-Straße, wo die Grenzen der drei Landschaftsschutzgebiete Elbsandsteingebirge, Böhmisches Mittelgebirge und Lausitzer Gebirge aufeinandertreffen. Dort steht ein kugelartiger Brunnen von Petr Menš, der aus den charakteristischen Gesteinen der drei Landschaftsgebiete (Sandstein, Basalt und Granit) besteht und am 10. August 2001 enthüllt wurde.
Im Norden der Stadt wurde 1895 einer der drei Teiche der ehemaligen Stadtbrauerei in ein Schwimmbad umgewandelt. Im Jahr 1916 wurde der Weiher betoniert und Anfang der 1920er Jahre komplett umgebaut. In den umliegenden Wäldern befindet sich ein großer Naturpark mit zahlreichen Ausflugszielen, von denen die bekanntesten das Miniaturdorf Mlýnky (Mühlen), die Felsaussichtspunkte Jehla (Nolde) und Ponorka (Unterseeboot) oder der Brüderaltar sind.
Eine weitere lokale Attraktion ist die 4,5 km lange Museumsbahn nach Kamenický Šenov, die 1886 von der Tschechischen Nordbahngesellschaft gebaut wurde. Ende September 1979 wurde der Personenverkehr auf ihr eingestellt. Im Oktober 1992 wurde die Strecke wegen ihres schlechten Zustands ganz geschlossen. Im Oktober 1992 wurde die Strecke aufgrund ihres schlechten Zustands vollständig stillgelegt. 1995 wurde die Strecke von den Freunden des örtlichen Eisenbahnclubs instand gesetzt, die von 1996 bis 2007 saisonale historische Züge auf der Strecke betrieben. Seit 2009 ist die KŽC s.r.o. Eigentümerin der Strecke und Betreiberin der Touristenzüge. Im Jahr 2000 wurden auf der Strecke einige Kampfszenen aus dem Film „The Dark Blue World“ gedreht.
Bedeutende Landsleute und Persönlichkeiten
Johann Klein (1681-1762), ein hervorragender Mathematiker und Erfinder astronomischer Uhren, Direktor der mathematischen Abteilung des Klementinums in Prag, wurde in Česká Kamenice geboren; Johann Baptista Pohl (1782-1834), Doktor der Medizin und Universitätsprofessor für Botanik in Prag, berühmt für seine naturwissenschaftlichen Forschungen in den brasilianischen Wäldern und hierzulande auch bekannt als Führer des deutschen Dichters J. W. Goethe in Böhmen. Zu den bedeutenden Einheimischen gehören auch die Maler Emanuel und Josef Hegenbarth. Emanuel Hegenbarth (1868-1923) war ab 1903 Professor an der Dresdner Kunstakademie und wurde vor allem durch seine Gemälde von Tieren und dörflichen Motiven aus der Umgebung berühmt, während Josef Hegenbarth (1884-1961) einer der bedeutendsten deutschen Illustratoren des 20. Jahrhunderts war und nach 1945 die Zwinger Galerie in Dresden leitete. Seine bevorzugten Motive waren Szenen aus dem Zirkus, später bevorzugte er biblische Themen und schuf den Kreuzweg für die St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin.
Aus Česká Kamenice stammten auch Jakob Frint (1766-1834), ein bedeutender Gelehrter, Theologe und Pädagoge, der 1827 Bischof in St. Pölten (Österreich) wurde, Johann Tille (1703-1760), Theologe und Professor an der Prager Philosophisch-Theologischen Fakultät, der auch Rektor der Universitäten in Znaim, Olmütz und Prag war sowie Raimund Maria Klaus (1812-1838), ein Dichter, Schriftsteller und Sammler von Sagen.
Der in Líska geborene Textilindustrielle und Mäzen Franz Preidl (1810-1889), der 1887 mit dem Prädikat „Edler von Hassenbrunn“ in den Adelsstand erhoben wurde, trug wesentlich zur Entwicklung der Stadt bei. Karel Liebscher (1851-1906), ein akademischer Maler und Illustrator, stellte die Umgebung der Stadt in seinen Zeichnungen dar. Johann Josef Klein (1693-1757), der 1734 Prager Hofbildhauer wurde, war ein bekannter Bildhauer. Auch der Bildhauer und Schnitzer Franz Thomas (1710-1773) wurde hier geboren.
Der aus Cvikov (Zwickau) stammende spätere Rektor des Allgemeinen Seminars in Prag, Direktor der Theologischen Fakultät in Wien und Hofrat Augustin Zippe (1747-1816) trug wesentlich zur Armenfürsorge und zur Entwicklung des Bildungswesens in Česká Kamenice bei.
Auch zwei Komponisten lebten in ihrer Jugend in Česká Kamenice. Der später bedeutende deutsche frühklassische Komponist und Opernreformer Christoph Willibald Gluck (1714-1787), dessen Vater Alexander Förster auf dem hiesigen Gut war, lebte als Kind von 1720 bis 1728 in Kamenice. Vom Herbst 1856 bis zum Sommer 1857 besuchte einer der bedeutendsten tschechischen Komponisten, Antonín Dvořák (1841-1904), die hiesige Bürgerschule, um sein Deutsch zu verbessern. Er wohnte bei Josef Ohm in der heute nicht mehr existierenden Oberen Mühle in Horní Kamenice und verbesserte seine Musiktheorie und sein Orgelspiel bei dem Chorleiter und Organisten Franz Hantschke.
Aus unbestätigten Dokumenten geht hervor, dass Karel Hynek Mácha zu Weihnachten 1835 Český Kamenice besuchte.
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung
In der Umgebung der Stadt gibt es eine Reihe interessanter Orte. Gleich oberhalb des nördlichen Stadtrandes befindet sich der steile Aussichtsfelsen Jehla (Nolde) unter dem sich im Wald der Bratrský oltář (Brüderaltar) und die Aussichtspunkte Ponorka (Unterseeboot) und Žába (Frosch) verstecken. Südöstlich der Stadt erhebt sich der Zámecký vrch (Schlossberg) mit der Ruine der Burg Kamnitz und einem hölzernen Aussichtsturm. Im Tal dahinter liegt Kamenický Šenov (Steinschönau), an dessen Rand sich das Naturdenkmal Panská skála (Herrenhausfelsen) befindet, das hierzulande und in der Welt als Basaltorgel bekannt ist. An die reiche industrielle Tradition von Kamenický Šenov erinnert das Glasmuseum. Interessant ist auch das Feuerwehrmuseum im nahe gelegenen Nový Oldřichov (Neu Ullrichstal).
Östlich von Česká Kamenice liegt ein langgestrecktes Gebirgstal mit den alten Glasmacherdörfern Kytlice (Kittlitz) und Mlýny (Hillemühl). Unmittelbar oberhalb der Stadt verengt sich das Tal zu einer felsigen Schlucht zwischen dem Břidličný vrch (Schieferberg) und dem Pustý zámek (Wüstes Schloss), dessen Felsvorsprung mit den Ruinen der Burg Fredevald als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Unweit davon erhebt sich der malerische Střední vrch (Mittenberg), unter dem das malerische Dorf Prysk (Preschkau) im Tal liegt.
An der Straße nach Chřibská (Kreibitz) liegt die Siedlung Líska (Hasel), die von mehreren Bergen umgeben ist. Die bekanntesten sind der mächtige Studenec (Kaltenberg) mit einem Aussichtsturm und der geschützte Zlatý vrch (Goldberg) mit einem einzigartigen Beispiel für die säulenförmige Zersetzung von Basalt. In der Nähe des Sattels U Křížového buku (An der Kreuzbuche) befindet sich das Naturdenkmal Líska mit einem ungewöhnlich großen Bestand an mehrjährigen Ringelblumen. Nördlich von Česká Kamenice liegen die Ortschaften Kunratice (Kunnersdorf), Lipnice (Limpach) und Studený (Kaltenbach). Vom nahe gelegenen Větrný vrch (Ottenberg) hat man einen schönen Blick auf die Böhmische Schweiz.
Westlich der Stadt fließt der Fluss Kamenice (Kamnitz) durch Janská (Jonsbach) nach Srbská Kamenice (Windisch Kamnitz), über dem sich der massive Růžovský vrch (Rosenberg) erhebt. Im nahe gelegenen Stara Oleška (Alt Ohlisch) befindet sich der beliebte Naherholungsteich Olešský rybnik (Ohlischer Teich). Nördlich von Srbská Kamenice liegt die bewaldete Landschaft der Böhmischen Schweiz mit attraktiven Felsenstädten bei Jetřichovice (Dittersbach), romantischen Schluchten des Flusses Kamenice und dem einzigartigen Pravčická-Tor (Prebischtor) über Hřensko (Herrnskretschen).
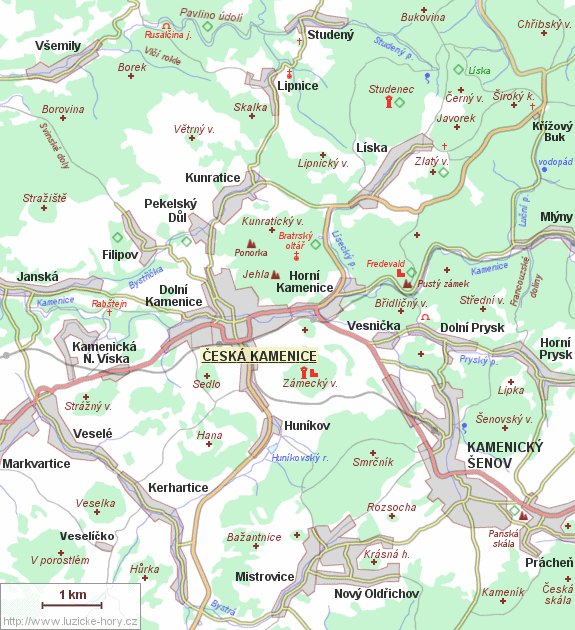
Weitere Informationen
- Historische Bilder von Česká Kamenice
- Aussicht vom Turm der St. Jakobus-Kirche in Česká Kamenice
- Unterkunft - Česká Kamenice



